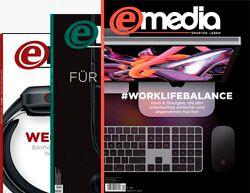„Datenschützer Technologiefeindlich? Bullshit!“
Mit seinen Anzeigen gegen Internet-Gigant Facebook hat Max Schrems schon für Furore gesorgt. Sein Ziel ist, zu klären, ob Rechte nur auf Papier stehen oder vor Gerichten einklagbar sind. Wir trafen den Juristen und Datenschützer zu einem Gespräch über seine Beweggründe, das neue Privacy-Projekt „noyb“ – und darüber, wie wir in Zukunft Datenschutzrechte besser durchsetzen können.
Was war Ihre Motivation, sich als Jurist so intensiv dem Datenschutz zu verschreiben?
Ich habe mich immer schon für Technologie und IT interessiert, da stößt man automatisch auf das Datenschutzrecht. Es ist auch ein spannendes Thema, wo sich viel tut und wenige auskennen. Was mich am meisten antreibt, ist die Rechtsstaatlichkeit, das heißt: Wenn wir Gesetze haben, so müssen wir uns daran halten. Zwischen den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und der Realität sind Meilen, wie selten in einem anderen Rechtsbereich. Und hier agieren nicht Hacker, sondern Großkonzerne, die an der Börse gehandelt werden.
Seit sechs Jahren zeigen Sie Datenschutzverletzungen durch Internet-Unternehmen auf. Fühlen Sie sich manchmal wie Don Quijote im Kampf gegen die Windmühlen?
Ja, aber das war von Beginn an klar. Wenn man eine Beschwerde einbringt, glaubt keiner, dass alles sofort perfekt wird. Mich interessiert, wie die Windmühlen funktionieren, warum die da stehen. Ich sehe das eher spielerisch, wie Pingpong, ich reiche etwas ein und schaue, wie reagiert wird. Anders hält man das nicht sechs Jahre durch. Ich habe auch nichts zu verlieren, die anderen aber sehr viel. Entscheidend ist im Datenschutz, faktentreu zu bleiben, um glaubwürdig zu sein. Immer wieder werde ich mit Verschwörungstheorien konfrontiert, aber dazu äußere ich mich nicht. Nur was laut Paragraf nachweisbar ist, darüber spreche ich. Auch habe ich nie Geld genommen, und das macht alle unrund, denn viele dachten, der gibt auf.
Sie haben gerade eine NGO gegründet, also einen gemeinnützigen Verein, was ist das Ziel?
Ja, das ist „noyb – Europäisches Zentrum für digitale Rechte“. Ich werde übrigens immer wieder gefragt, wie man das ausspricht – ganz einfach „noib“. In der Digitalisierung bewegt sich unglaublich viel, und wir müssen entscheiden: Wie sieht die digitale Welt aus, wer hat die Rechte, wer bekommt was vom Kuchen und wer kriegt nur Krümel? Beim Datenschutz geht es um die Hoheit über die Daten, die auf meinem Device sind. Aus meinen Erfahrungen habe ich festgestellt, dass etwas fehlt. Wir haben NGOs, die sich mit staatlicher Überwachung beschäftigen. So kümmert sich bei uns „epicenter works“ um das österreichische Derivat der Vorratsdatenspeicherung. Dann gibt es NGOs auf EU-Ebene, die haben auf die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geschaut, die ab 25. Mai 2018 europaweit natürlichen Personen mehr Rechte gibt. Das ist fußballtechnisch das Mittelfeld. Aber was fehlt, ist der Stürmer, der den Ball ins Tor schießt, sonst hast du am Ende nicht gewonnen. Das ist die Aufgabe von „noyb“. Zu schauen, dass wir uns an die Gesetze halten, die wir jetzt haben.